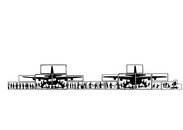Matthias Böhler & Christian Orendt (DE), Daniel Buren (FR), Jan Caspers, Anne König, Vera Tollmann & Jan Wenzel (DE), Bertram Haude (DE), Chris Johanson (US), Dani Karavan (IL), Mischa Kuball (DE), Peter Land (DK), Lutz&Guggisberg (CH), David Mannstein (DE), Tracey Moffatt (AU), Eva-Maria Raschpichler (DE), Peter Santino (US), Gregor Schneider (DE), Roman Signer (CH), MÃ¥ns Wrange (SE)
Irren ist menschlich und aus Erfahrung wird man klug, sagt man. Dennoch fehlt uns der positive Umgang mit dem Fehlerhaften und dem Irrtum. Individuelles wie gemeinschaftliches Versagen wird tabuisiert oder gebrandmarkt. Dabei dient es oft als ein Schrittmacher, ohne den gesellschaftliches Umdenken und qualitative Veränderung kaum möglich wären. Entwicklung bedarf der Umwege.
Die holprigen, doch nie ziellosen Schleichpfade der biologischen und kulturellen Evolution sind gesäumt von vergeblichen Versuchen. Motor ihres steilen Aufstiegs ist die Inkaufnahme von Fehltritten. Dennoch wünschen wir uns nichts sehnlicher als eine perfektionierte „Null-Fehler-Kultur“. Steckt diese aber nicht auch voller Strapazen und Fehlschläge, sodass man ebenso von einer Irrtumsgesellschaft sprechen könnte? Führt uns nicht gerade diese Welt des Unvollendeten und Fehlerhaften, gepaart mit einem fröhlichen Eingeständnis eigener Fehlertauglichkeit, zu jenen Auswegen und kulturellen Anknüpfungspunkten, über die sich all die Geschichten des Scheiterns neu für uns erschließen? Einem Scheitern, das eben nicht nur Verlust und Insolvenz in einer von Schwarz-Weiß-Ansichten geknechteten, aus dem Gleichgewicht geratenen Welt bedeutet, sondern gepflegt und kultiviert wird, um uns die Furcht vor dem Versagen zu nehmen? Ist unsere sinnliche Wahrnehmung, unser Erfahrungsschatz angesichts eines überbordenden, in virtuellen Welten eingebetteten abstrakten Wissens überhaupt noch imstande, Fehler einzugestehen, zu bewältigen, zu korrigieren?
Der Kunstfehler ist ein Begriff aus der Medizin, dem etymologisch zugrunde liegt, dass die ärztliche Behandlung nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ausgeführt werden muss (im Lateinischen „de lege artis“, im Englischen „the state of the art“– „nach den Regeln der Kunst“). Der Medizin wohnt seit jeher die Schwierigkeit inne, praktisches Wissen unter den Bedingungen der Realität umzusetzen. Ihr obliegt eine elementare Verantwortung für Qualität und das Wohl des Patienten, für dessen Beratung und restlose Aufklärung über bevorstehende Maßnahmen sowie für die Erläuterung aller bestehenden Risiken. So möge es sich vielleicht auch mit der Kunst verhalten. Vielleicht liefern die Regeln der Kunst aber auch die Bausteine für jene letzte Bastion, die sich nicht scheut vor würdevollem Scheitern, lustvollem Irren, leidenschaftlichem Versagen, dem Reiz der Niederlage: Nicht die Wissenschaft oder das Handwerk, sondern die Kunst ist das Paradies für Genies, der letzte Zufluchtsort für Versager, an dem Misslingen Aufbruch wird.
Der Kunstfehler oder das fehlgeschlagene Kunstprojekt zeitigt– ob vorsätzlich erdacht oder unbeabsichtigt– nicht selten das schlüssigere Resultat, wenn es Idee, Versuchsanordnung, Prototyp, Beschreibung, Simulation bleibt. Spannend am lediglich erdachten, nie begonnenen oder vollendeten Werk kann z.B. sein, dass es Einblicke in den Schöpfungsprozess gewährt. Ein Dichter sagte: „Vielleicht ist das Scheitern des Versuchs Einsteins, eine allgemeine Feldtheorie aufzustellen, für die Physik sein wichtigster Beitrag.“ Künstler, die das Scheitern eines ihrer Projekte thematisieren (Kunstfehler), sind ebenso an der Ausstellung beteiligt wie Künstler, die sich in ihrer Kunst mit dem Scheitern und Fehlerhaften per se auseinandersetzen (Fehlerkunst). Und warum soll für den Künstler nicht zutreffen, was Friedrich Nietzsche in der „Fröhlichen Wissenschaft“ sich selbst zuschreibt: „Er ist ein Denker, das heißt, er versteht sich darauf, die Dinge einfacher zu nehmen, als sie sind.“
Matthias Böhler & Christian Orendt
Immanuel Kant beginnt seine „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ mit den Worten: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.“ Nach Kant bemisst sich die moralische Güte des Willens nicht daran, was er zu bewirken im Stande ist, sondern allein am Wollen selbst– mögen die Folgen auch katastrophal sein. Die gezeigte Installation von Matthias Böhler, geboren 1981, und Christian Orendt, geboren 1980, ist der zweite Teil einer Trilogie mit dem Titel „Der gute Wille“ (2009), die sich mit dem Fehlerpotenzial von sich verselbstständigenden industriellen Produktionsabläufen auseinandersetzt. In diesem zweiten Teil veranschaulicht ein Panoramamodell einer Fischmehlfabrik im Maßstab 1:58 die Herstellung und die Distribution von Fischmehl, einem Produkt, das vornehmlich als Zutat bei der Tierfuttererzeugung eingesetzt wird. Auf den ersten Blick scheint dieses Panorama zunächst einfach den reibungslosen Ablauf der unterschiedlichen Vorgänge bei der Fischmehlproduktion zu illustrieren: Trawler fahren auf die hohe See hinaus und fangen Fische. Diese werden in der im Hafen befindlichen Fischmehlfabrik verarbeitet. In dem Moment, in dem der aufmerksame Betrachter jedoch feststellt, dass das feinkörnige Produkt in Muldenkipper verladen wird, bleibt ihm kaum etwas anderes übrig, als vom Glauben an eine sinnvolle Ordnung des Laufs der Dinge abzufallen. Bei einer weiteren Inaugenscheinnahme der Lieferkette erhärtet sich dieser Verdacht: Die Aufgabe der dienstbeflissenen Transportknechte ist es, das frisch gemahlene Fischmehl an den Endverbraucher, eine nicht ganz geheuer wirkende große schwarze Katze, auszuliefern. Emsig drehen sie ihre Runden zwischen der Fabrik und einem höher gelegenen Felsplateau, von dem aus sie ihre Fracht in die Tiefe schütten. Das beschriebene Szenario wirft die Frage auf, ob es sich hier um die Darstellung einer Win-Win-Situation handelt. Erwächst den wackeren kleinen Lastkraftwagen irgendein Vorteil aus ihrem ununterbrochenen Tätigsein? Handelt es sich bei ihnen um Mildtäter, um Tierhalter, um verbündete Zulieferer oder um Ausgebeutete? Und ist die Katze einfach nur ein am Tisch bettelndes Haustier oder vielleicht doch eher ein dämonischer Herrscher, der Angst und Schrecken unter seinen Untertanen verbreitet und ihnen auf diese Weise ihr wertvolles Trockenfischerzeugnis abpresst?
Daniel Buren
Daniel Buren, Jahrgang 1938 und „lebende Legende“ aktueller Kunst, gilt als Vertreter der analytischen Malerei und der Konzeptkunst. Der französische Maler und Bildhauer entwickelte seine Arbeit Ende der 1960er Jahre aus einer kritischen Auseinandersetzung mit der traditionellen Malerei heraus. Seine längst zum Markenzeichen gewordene Abfolge von 8,7 Zentimeter breiten weißen und farbigen Streifen dient ihm seit über 40 Jahren als wirkungsvolles visuelles Instrument. Buren legt das Hauptaugenmerk seiner Arbeiten grundsätzlich auf den jeweiligen Ort, die Zeit und die Umstände ihrer Anbringung. Seine künstlerischen Eingriffe, zu denen die Gestaltung von Plätzen und öffentlichen Bauten zählt, reagieren stets auf das, was real gegeben ist. Auf Einladung von Bernd Kauffmann, Generalbeauftragter der „Weimar 1999– Kulturstadt Europas GmbH“, wollte Buren den Rollplatz der Klassikerstadt umgestalten. Aus über 100 Betonsäulen verschiedenster Höhe sollte ein bunter Stelenwald entstehen. Stattdessen brach ein Sturm los. Bürger hatten Tausende von Unterschriften gegen die Platzumgestaltung gesammelt. Auch die Medien spielten, z.B. mit der Vorabveröffentlichung nicht autorisierter Computersimulationen der künstlerischen Platzgestaltung, in der Auseinandersetzung eine wesentliche Rolle. Heftiger stritt man in Weimar wohl noch nie über Kunst und den öffentlichen Raum. Die Bürgerschaft gab sich gespalten. Teile äußerten Entsetzen, andere demonstrierten engagiert für das „Projekt für den Rollplatz“ (1997–99). Am Ende blieb der Rollplatz so schön wie eh und je: ein Parkplatz.
Jan Caspers, Anne König, Vera Tollmann, Jan Wenzel
Einer der wenigen Sätze, die in Ost- wie in Westdeutschland gleichermaßen Zustimmung fanden, lautete: „Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen.“ Bei der Suche nach dem Urheber war man sich wieder uneins: War es Willy Brandt, West, oder Wilhelm Pieck, Ost? Egal, wichtiger wäre ohnehin, zu definieren, was dieser Leitsatz meint. Man könnte der Ansicht sein, dass bereits mit jedem Rüstungsexport potenziell Krieg von deutschem Boden ausgehe– Deutschland gilt als drittgrößter Rüstungsexporteur der Welt. Man könnte zudem der Auffassung sein, dass von Deutschland bereits dann Krieg ausgeht, wenn es die Infrastruktur bietet, die zur Kriegsführung nötig ist. Die Kunst ist prinzipiell ein guter Ort, um sich in solchen Fragen Klarheit zu verschaffen. Doch selbst Künstlern, denen gern Narrenfreiheit nachgesagt wird, droht hier schnell der Maulkorb. Jan Caspers, geboren 1970, Anne König, geboren 1971, Vera Tollmann, geboren 1976, und Jan Wenzel, geboren 1972, können davon eine eigene Geschichte erzählen. 2008 waren die vier eingeladen, am Projekt „AusFlugHafenSicht“ des Thalia Theaters Halle teilzunehmen. Der Flughafen Leipzig/Halle ist ein Sahnestück des Aufbaus Ost. Nur lässt die Auslastung zu wünschen übrig. Daher könnte man es als Segen bezeichnen, dass der Standort zumindest als Frachtdrehkreuz und als Knotenpunkt für US-Truppentransporte gut gefragt ist. Von DHL verspricht sich die Region Tausende neuer Arbeitsplätze. Mehr als 200 Stellen sollen auch dem Umstand zu verdanken sein, dass jährlich mehr als 300.000 Soldaten, genaue Zahlen gibt es nicht, in Leipzig/Halle abgefertigt werden. Offiziell handelt es sich dabei übrigens nicht um Militärtransporte, denn zivile Gesellschaften wickeln die Flüge ab, Outsourcing hab Dank. Caspers, König, Tollmann und Wenzel jedenfalls fanden diese Aspekte sehr interessant und entwickelten mit „Was Du wissen solltest (Die Zukunft)“ ein 27 Meter langes Wandbild und eine 24-seitige Zeitung, um der Komplexität mitsamt ihrem Konfliktpotenzial gerecht zu werden. Ein Erzählstrang der Bildergeschichte sollte zeigen, wie ein Kind, das offenbar weit entfernt wohnt, bei den Großeltern den Teddy vergisst, welcher dank Luftfracht über Nacht hinterher reist. Ein anderer Strang hätte gezeigt, wie eine katastrophale Bilanz zu Geschäften mit dem Pentagon führt, und wie Väter in Uniformen und in Flugzeuge steigen, in Leipzig speisen, im Irak oder in Afghanistan kämpfen und sich, zurück in der Kantine in Leipzig, die sie wirtschaftlich gerettet haben, ihre Digitalfotos zeigen. Der Flughafen steckt voller Geschichten. Einige sollten nicht nach außen dringen. Jedenfalls war es die von den Künstlern hinzunehmende „FlugHafenAnSicht“ des Betreibers, das Wandbild und die Verteilung der Zeitung in seinem Einflussbereich zu verbieten. Selbst wenn fraglich sein sollte, ob von deutschem Boden Krieg ausgeht, sicher ist: Vom Flughafen Leipzig/Halle geht es gut gestärkt in den Krieg.
Bertram Haude
Das unerwartete Potenzial gängiger, massenproduzierter Konsumartikel offenbart Bertram Haudes unbetiteltes Objekt von 2007. Die optionalen Vorgaben eines schlichten Normregals „im schwedischen Stil“ wurden beim Wort genommen und jede Möglichkeit für das Einlegen weiterer Regalbretter ausgeschöpft. Seinen planmäßigen Zweck verfehlend (oder über die Maßen erfüllend), erscheint das Möbelstück nunmehr als Skulptur, die jeglichen Gebrauch verweigert. Die Auflösung seiner Funktionalität hat zugleich eine veränderte ästhetische Dimension zur Folge.
Chris Johanson
In den farbenfrohen Bildwelten von Chris Johanson, geboren 1968, trifft eine gegenständliche auf eine abstrakte Bildsprache. Johansons installative Malereien sprengen die Gattungsgrenzen zwischen Malerei und Skulptur. Verwurzelt in der Community der Mission Street von San Francisco, setzt sich der Künstler mit Themen des urbanen Realismus und der Ästhetik der Straßen auseinander. In seine Werke fließen neben Elementen, die der Künstler aus der Comic- und Graffitiszene entlehnt, auch Op- und Pop-artige Bildeffekte als kunsthistorische Verweise sowie recycelte Bild-und Textfragmente ein, die als Wirklichkeitszitate dienen. Johansons aus formaler Sicht plakative und einfache Bildsprache ist geprägt von einem scheinbaren handwerklichen Dilettantismus, welcher sich weder um eine einheitlich konstruierte räumliche Perspektive bemüht, noch den naiv-simplifizierten Bildfiguren natürliche Proportionen und Haltungen angedeihen lässt. Doch in den vordergründig humoristisch anmutenden Zeichnungen und der ostentativ heiteren Farbigkeit seiner Malerei steckt eine kritische Sicht auf unsere Welt. So entpuppen sich die Arbeiten von Johanson immer auch als Kommentare zu politischen und gesellschaftlichen Zuständen und thematisieren auf ihre Art Missstände, eine Fehlbarkeit innerhalb bestimmter Systeme.
Dani Karavan
Der international renommierte Bildhauer und Gestalter Dani Karavan, geboren 1930, lebt und arbeitet in Tel Aviv und Paris. Ausgehend von der Geschichtlichkeit eines Ortes entwickelt er in seinen großformatigen, begehbaren Kunstwerken mittels komplexer Zeichensetzungen vielfältige gesellschaftliche, historische und politische Bezüge, transformiert aus den Potenzialen der Erinnerung neue sinnliche und kommunikative Erfahrungsräume. Dennoch sind zahlreiche seiner Werke, die er für den öffentlichen Raum konzipierte, unrealisiert geblieben, unter ihnen das Projekt „Heidelberg Uniplatz“, das vom Rektor der Universität persönlich verhindert wurde. Karavan selbst beschreibt den Hergang wie folgt: „Zu Beginn der 1980er Jahre wurde ich gefragt, ob ich ein Kunstwerk schaffen könnte, eine Skulptur für die Stadt Heidelberg. Nachdem ich mich in der Stadt umgeschaut hatte, wählte ich dafür den Uniplatz. Während ich meine Arbeit plante, erfuhr ich, dass der Platz Schichten um Schichten von Heidelbergs Historie unter sich verbirgt. (…) Das gesamte geschichtsträchtige Terrain lag im Verborgenen, versiegelt von einem befestigten Platz, der von den Nazis als Marschplatz benutzt wurde. Als ich zum ersten Mal dorthin kam, war der Platz menschenleer, während sich die Studenten in den umliegenden Kleinstraßen drängelten, ohne einen angemessenen Ort, um sich zusammen zu finden. Mein Ziel war es, den Platz in einen >Studentenplatz< zu verwandeln, es Studenten zu ermöglichen, auf ihm, auf seinen Elementen zu sitzen, Veranstaltungen abzuhalten, sich zu versammeln, zu lesen und sich im Winter die Hände in Thermalwasser zu wärmen, das in seinem Zentrum fließen würde. (…) Der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Reinhold Zundel, liebte das Projekt und ihm wurde erzählt, dass die meisten Stadtratsmitglieder ihn unterstützen würden, aber der Rektor der Universität, Prof. Dr. Gisbert Freiherr zu Putlitz, der Einwände gegen das Projekt hatte, sagte mir, dass er es nicht mögen würde, Leute auf dem Platz sitzen zu sehen, sondern ihn lieber leer sähe, wenn er aus dem Fenster schaut. Er erzeugte Druck gegenüber einigen Mitgliedern des Stadtrats, die für die Universität verantwortlich waren; mir wurde erzählt, dass sie sogar bedroht worden wären.“ So zählt „Heidelberg Uniplatz“ (1985– 1986/2009) nun zu jenen 60 Projekten Karavans, die von den Auftraggebern zwar bestätigt, aber aus bisweilen obskuren Gründen nie verwirklicht wurden. „Nach meiner Auffassung ist dies eigentlich der normale Zustand, während ich es als Wunder betrachte, wenn ein Projekt realisiert ist,“ so das Resümee des Künstlers.
Mischa Kuball
Mischa Kuball, Jahrgang 1959, kann bereits auf ein vielschichtiges Å’uvre aus architekturbezogenen Interventionen, Installationen, Videoprojektionen und publikumsbezogenen Performances zurückblicken, in dessen Zentrum stets ein Medium steht: Licht. Insofern war der Düsseldorfer Künstler eine Idealbesetzung für die Ausstellung „Licht auf Weimar– die ephemeren Medien“ im Jahr 1999. Groteskerweise durfte ausgerechnet sein Beitrag „sprach platz sprache“ (1999) nicht umgesetzt werden. Kuball plante eine Licht- und Sprachinstallation. Vom Turm des ehemaligen Weimarer Gauforums aus, mit dessen Bau die Nazis 1937 begonnen hatten, sollte „eine andere, ephemere und nur auf zeitliche Präsenz angelegte Platzstruktur“ erschaffen werden, so der Kurator Ulrich Krempel. Den Parkplatz vor dem Gebäude-Ensemble hätte die Arbeit erhellt und so die Komplexität von unseliger Geschichte und ihren architektonischen Nachwirkungen sichtbar machen können. Der Scheinwerfer hätte, gesteuert von einem Zufallsprogramm, den Platz abgetastet. Nach plötzlichem Innehalten der Bewegung hätte eine Klangstruktur eingesetzt, die „eine undeutliche und nicht dekodierbare Sprache benutzt, um sich auf dem Platz akustisch zu verorten“, so Kuball selbst. Dem Thüringischen Landesverwaltungsamt als Nutzer des Gebäudekomplexes gefielen die Assoziationen, die das Werk auslösen könnte oder wollte, nicht. Zu nah offenbar waren noch die Suchscheinwerfer des nahe gelegenen ehemaligen KZ Buchenwald, zu groß womöglich die vermeintliche Nähe zu Albert Speers pompösen Lichtdomen, zu unkalkulierbar die Gefahr drohender Neonazi-Aufmärsche an diesem historisch geladenen Ort. Via Hausrecht bremste das Verwaltungsamt die Arbeit aus. Der Innenraum des abstrahierten Grundrisses des ehemaligen Gauforums, jener Ort also, der im Original als SS-Aufmarschplatz geplant war und später zum ausgedehnten Parkplatz modifiziert wurde, ist im Ausstellungsmodell ebenso ornamentartig mit Zeitungsbeiträgen zum Kunstwerk Kuballs ausgestattet und wird willkürlich-regellos von einem Scheinwerfer abgetastet. Auch der Katalog, der das nie realisierte Werk vorstellt, ist einzusehen. Er enthält die in Kooperation mit Harald Grosskopf aufgenommene CD „Der Himmel über dem Gauforum Weimar 1999“, welche die besagte Klangstruktur wiedergibt und nun in der Ausstellung zu hören ist.
Peter Land
Der dänische Künstler Peter Land, Jahrgang 1966, ist bekannt geworden durch seine performativen Videoarbeiten, in denen er sich immer wieder mit dem Thema des Scheiterns und der Absurdität des menschlichen Daseins befasst und dies am eigenen Leib erforscht. Die zunächst burleske Stimmung in „Pink Space“ (1995), die durch einen Mann hervorgerufen wird, der in scheinbar unendlicher Folge– ein Whiskeyglas in der Hand– einen Raum betritt, schlägt mit der Zeit in eine groteske um, beobachtet man ihn doch beim Versuch, sich auf einem Barhocker niederzulassen, von welchem er stets aufs Neue kippt. Peter Lands Arbeiten besitzen trotz ihrer slapstickhaften Manier eine gewisse Tragikomik, innerhalb derer sie auf einen illusionslosen Umgang mit den Grenzen und Bedingungen von Identität zielen, um diese wiederum neu denken zu können. So zieht der Künstler– musikalisch untermalt von Beethovens Pastorale– in „The Lake“ (1999) als Jäger in die Wälder, um sich dann in idyllischer Seenlandschaft mit einem Gewehrschuss ins eigene Boot schlussendlich selbst zu versenken.
Lutz&Guggisberg
Seit 1996 arbeiten die Schweizer Künstler Andres Lutz, geboren 1968, und Anders Guggisberg, geboren 1966, als Künstlerduo zusammen und haben seitdem eine komplexe und zugleich einfache künstlerische Sprache entwickelt, die sich durch eine mediale, formalästhetische sowie inhaltliche Dichte und Präsenz auszeichnet. So werden oftmals skulpturale und objekthafte Arbeiten mit Video gepaart und zu einem Gesamt-Ensemble komponiert, das uns die Welt, in der wir leben, mal in makrokosmischen Dimensionen und dann wieder extrem komprimiert als künstlerische Assemblage präsentiert. Die Präsentation ihrer Schaustücke ist so klassisch wie ironisch: Altmodische Sammelkästen bersten schier vor der Vielzahl an tierischem Inventar, gläserne Vitrinen versammeln Devotionalien jeglicher Couleur. Lutz&Guggisberg sind Grenzgänger, die ihre Arbeiten im Zwielicht zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit ansiedeln. Ihr Werk ist durchzogen von komplexen Verweissystemen, in denen alles zusammenhängt und sich gegenseitig bedingt. Mit der Serie „Pokale, Preise und Trophäen“, aus der die Arbeit „Bravo!“ (2000) zu sehen ist, werden weitere Fundstücke reaktiviert, mitunter auf kleine Sockel montiert und mit Lobschriften versehen. Jene Auszeichnung, deren Sockelplatte mit der Inschrift „Bravo!“ das Verdienst als solches nochmals betont, spielt einerseits auf die latente Beliebigkeit des Preisverleihungswesens und die Auszeichnungen im Kunstbetrieb an und hinterfragt zugleich gängige Kategorien der Beurteilung von Kunst. Andererseits bleibt offen, ob sich der oder die Geehrte um die Ab- oder Aufrüstung, die Spielzeugindustrie, jüngste Militärfeldzüge weltweit oder etwas ganz Anderes verdient gemacht hat. Im Mittelpunkt der Lutz&Guggisberg’schen Belohnungskultur steht prinzipiell der gute, brave Mensch, der die Menschheit bereichert hat, ob als Erfinder, Träumer oder in verzweifeltem Scheitern, ob er nun für sein Lebenswerk, eine gütige Geste oder eine selbstlose Tat geehrt wird: „machte Herrn Schütz fünfzehn Jahre lang die Wäsche und ist mit einer Dampfschifffahrt zufrieden“, „sah die Wahrheit, verschonte aber die anderen damit“ oder „sagte Helmut nichts, als dieser von Inge mit Volker betrogen wurde“.
David Mannstein
Am 19. März 1970 kamen Willi Stoph, DDR-Ministerpräsident, und Willy Brandt (SPD), Bundeskanzler der BRD, in Erfurt zum ersten deutsch-deutschen Regierungstreffen zusammen. Schauplatz war das Hotel „Erfurter Hof“ direkt am Hauptbahnhof. Eine begeisterte Menge, von Tausenden ist die Rede, rief damals „Willy, Willy“ und „Willy Brandt ans Fenster“– und Willy zeigte sich. Im Zuge des Bahnhofsumbaus, der Neugestaltung des Vorplatzes und der Sanierung des „Erfurter Hofs“ kam der Wunsch nach einer konkreten Form der Ehrung Brandts an diesem Ort auf. Der Stadtrat beschloss, einen Wettbewerb auszuloben mit dem Ziel der künstlerischen Gestaltung eines Denkmals, das Willy Brandts Engagement zur Annäherung beider deutscher Staaten anlässlich des Treffens im März 1970 würdigen sollte. Aus 123 Einsendungen ging der Entwurf des Berliner Konzeptkünstlers David Mannstein, geboren 1958, als Sieger hervor. Wie so oft, war die Diskussion mit der Juryentscheidung nicht beendet, sondern brach, im Gegenteil, erst los. Die Gemüter erhitzten sich vor allem an dem Umstand, dass der Künstler auf dem Erfurter Hof den erleuchteten Schriftzug „Willy komm ans Fenster“ anbringen wollte. Einigen Duellanten war dies der künstlerischen Freiheit zu viel, müsste es doch historisch korrekt heißen: „Willy Brandt ans Fenster“. Der Künstler lenkte ein. Fortan mühte sich die CDU an verschiedenen Fronten, das Kunstwerk mit der Begründung zu verhindern, dass es dem Anlass unwürdig sei. Während die Debatte um den Entwurf in der Öffentlichkeit hoch emotionalisiert geführt wurde (wie ein Mitschnitt einer Erfurter Stadtverordnetenversammlung zeigt), einigte man sich nach einem Jahr auf politischer Ebene hinter verschlossenen Türen. In „Kunstfehler– Fehlerkunst“ tritt der verwirklichte Schriftzug „Willy Brandt ans Fenster“ in Korrespondenz mit der vom Künstler intendierten, von der Stadt Erfurt jedoch abgelehnten Formulierung. „Komm“ und „Brandt“ stehen sich nun gegenüber. Als trotzige Mahnung vielleicht, die Freiheit der Kunst ernster zu nehmen, ganz sicher aber als Zeichen dafür, wer letztlich am längeren Hebel sitzt. Seine künstlerische Arbeit beschreibt Mannstein wie folgt: „Ich suche keinen Ausstellungsplatz für meine Kunst, sondern entwickle Arbeiten für einen Ort oder eine Situation. Ich arbeite mit Kontexten, Bedeutungen und Assoziationen. Dem künstlerischen Entwurf geht eine intensive Auseinandersetzung mit Funktion, Bedeutung, Aura, Historie etc. voraus. Ziel ist es, die Sicht zu öffnen auf die Dinge hinter den Dingen, die Aufmerksamkeit auf das Besondere im Alltäglichen zu lenken. Das Alltägliche ist das Umfeld und Gegenüber der Kunst.“ Leider sind es manchmal die Dinge hinter den Dingen, ist es das Alltägliche, das der Kunst die Luft zum Atmen– und damit ihre „Wettbewerbsfähigkeit“– nimmt.
Tracey Moffatt
Sydney trug im Jahr 2000 die Olympischen Spiele aus. Im Vorfeld fragten Organisatoren bei Tracey Moffatt an, ob sie sich vorstellen könne, die Wettkämpfe als offizielle Fotografin zu begleiten. Die Künstlerin konnte, bloß ließen die Ausrichter nie wieder von sich hören. Die Idee keimte dennoch. Moffatt, 1960 in Brisbane geboren, heimisch in Sydney und New York, hätte ohnehin mehr Interesse an den Verlierern als an den Gewinnern gehabt. Die ersten Drei erhalten eine Medaille. Moffatt konzentrierte sich auf den darauf Folgenden. „Vierter heißt, du bist fast gut. Nicht der Schlechteste (was immerhin seinen eigenen verdrehten Reiz hat), sondern beinahe unter den Besten. Fast ein Star!“, meint die Fotografin und Filmemacherin, Installations- und Objektkünstlerin. Die Olympiade verfolgte sie am Fernseher und fotografierte die Mattscheibe genau in den raren Momenten, in denen der Viertplatzierte, diese tragische Gestalt, auftauchte. Diese Fotos bildeten die Grundlage der 26-teiligen Serie „Fourth“ (2001). Die Künstlerin hob ihre Helden, allesamt Beinah-Stars, optisch hervor und ließ die Bilder auf Leinwand drucken. Oft senken sich die Blicke der Besiegten, manchmal reißen sie den Kopf nach oben oder zur Seite, nicht selten gratulieren sie den Siegern. Immer handelt es sich um intime, extrem emotionale Momente. Enttäuschung, Schaudern, die Erkenntnis, einen Platz auf dem Siegerpodest verpasst zu haben. „Meist besteht ihr Ausdruck in völliger Ausdruckslosigkeit“, sagt Moffatt. „Es ist ein so bestimmter starrer Blick, der sich über das Gesicht legt. Es ist eine schreckliche, schöne, wissende Maske, die sagt: ‚Oh s…t!’“ Auf höherem Niveau als bei Olympischen Spielen lässt sich schwerlich scheitern.
Eva-Maria Raschpichler
Die Arbeiten von Eva-Maria Raschpichler, Jahrgang 1980, sind Wahrnehmungsangebote an den Betrachter. In subtilen, raumbezogenen Interventionen reagiert die Künstlerin auf situative Gegebenheiten. Ihre Videos verwandeln banale Alltagsgegenstände in Objekte und Wesen einer jenseitigen Märchenwelt. Jene Arbeiten, wie auch ihre Zeichnungen, übermalten Fotografien und Collagen sind erfüllt von einer poetischen Bildsprache, welche die Flüchtigkeit und Transzendenz von Ereignissen erfahrbar machen, sich jedoch bewusst einer perzeptiven Greifbarkeit entziehen. Dies gilt auch für die Videoarbeit „zwischending und fall“ (2004), die in der Ausstellung „Kunstfehler– Fehlerkunst“ zu sehen ist. Die Kamera filmt ein Mädchen, das auf einem Hügel steht. Durch fortlaufenden, langsamen Zoom rückt die Person zusehends in die Ferne, bis sie schließlich mit wenigen Schritten hinter dem Hügel verschwindet. Durch einen zweiten digitalen Aufnahmevorgang, der das Video während des Spulvorgangs abfilmte, wurde ein durch den Spulprozess auf dem Videoband produzierter technischer Bildfehler Teil des Videos. Der sichtbare Überrest in Form der Videorekorderspur bleibt an den Bildern haften und wird zum eigentlichen Bildmoment. Die mediale Überlagerung bleibt nicht ohne Folge für die Wirklichkeit. So scheint es, als wüchsen dem Mädchen Flügel. Die Kombination zweier technischer Anwendungen dokumentiert einerseits einen technischen Fehler und ermöglicht andererseits die Wahrnehmung eines magischen oder transzendenten Ereignisses.
Peter Santino
Die Internetprojekte, Gemälde und Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Peter Santino, geboren 1948, beziehen ihre Schönheit und Faszinationskraft häufig aus Aspekten des Vergänglichen und Vergeblichen. Ungeachtet der gesellschafts-politischen Themen sind Santinos Arbeiten immer auch Parabeln auf das Zerfallen der Bilder, auf das Scheitern von Kommunikation in der nur scheinbar reibungslos arbeitenden Medienmaschinerie. Vom 14. bis zum 23. Juni 2009 gastierte Santino als „Pate des Scheiterns“ („Godfather of Failure“) in der ACC Galerie Weimar. Dort saß er in einem bequemen Sessel, um Anfragen von Menschen, die über das Scheitern und Themenverwandtes sprechen wollten, zu beantworten und diese Personen zu betreuen. Darüber hinaus war Santinos förmliche Entschuldigung für ein Leben mit der Kunst zu sehen, die sich gleichermaßen an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, an die ACC Galerie Weimar und die HALLE 14 in Leipzig richtete. Sie war– und ist es in der HALLE 14 erneut– in Blindenschrift aus Sand geformt und damit ebenfalls zum Scheitern verurteilt, denn Blindenschrift will ertastet werden, doch Sandhäufchen halten dem Händedruck nicht stand. Der Text lautet (in deutscher Übersetzung): „Am 25. Januar 1968, als ich meine kreative Arbeit begann, fühlte ich mich sicher, dass ich etwas anzubieten hätte, eine Vision, etwas, das man der Welt anbieten könne. Jetzt, mehr oder weniger 41 Jahre später, ist deutlich geworden, dass das, was ich anbieten kann, meine aufrichtige Entschuldigung ist. Vor 19 Jahren erkannte und verstand ich mein Scheitern; mein Scheitern, ein messbares Niveau künstlerischer Kommunikation zu erreichen. Trotz zahlloser Ausstellungen und mehr als ausreichender Gelegenheiten, meine Vision darzulegen, wurde nichts erreicht. Ich muss mich entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich meinem Ego erlaubt habe, mich von meiner Cleverness zu überzeugen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich diese Cleverness meine Arbeit durchdringen ließ. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich angenommen hatte, meine Vision hätte das Zeug zum Erfolg.“ Von 1990 bis 1999 bot Santino mit seinem „Institut des Scheiterns“ („Failure Institute“) eine Denkfabrik, Ideenschmiede (Thinktank) und eine Art Vermittlungsort für jene, die beunruhigt über das fortwährende Scheitern waren. Fellowships wurden ausgelobt (vornehmlich als Gegenleistung für Spenden). 1994 bekam das Institut eine Internetpräsenz. Viele Projekte wurden speziell für das World Wide Web ausgeführt, was positive wie negative Beachtung fand. Am 31. Dezember 1999 um 23:59:59 Uhr GMT (Greenwich Weltzeit) löschte der Künstler alle Daten vom Server und das Institut des Scheiterns hörte auf zu existieren. Doch natürlich begann das Scheitern gerade erst.
Gregor Schneider
Gregor Schneider, Jahrgang 1969, trat Anfang der 1990er Jahre mit subtilen, kaum wahrnehmbaren Raumeingriffen an die Öffentlichkeit. So verdoppelte er existierende Wände und Räume in Galerien und Museen. Legendär ist sein über Jahrzehnte immer wieder umgebautes „Haus u r“ in Rheydt. Teile davon hat er ausgebaut und auf eine internationale Ausstellungstournee geschickt, deren Höhepunkt die Teilnahme an der Kunstbiennale von Venedig im Jahr 2001 darstellt. Schneider errichtete im Deutschen Pavillon einen klaustrophobischen Komplex aus 22 Zimmern, Fluren und Abseiten– ein Werk, für das er die begehrte Auszeichnung des Goldenen Löwen erhielt. Schon früh äußerte der Künstler, dass ihn die „Beschäftigung mit dem Unbekannten“ fasziniere: „Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto unbekannter wird es für mich. Das ist für mich die Herausforderung, nämlich es auszuhalten, immer weiter auf der Stelle zu treten.“ In jüngerer Vergangenheit stellt Schneider seine künstlerischen Auseinandersetzungen verstärkt in den Kontext gesellschaftlich relevanter, öffentlich jedoch nicht zugänglicher Räume. Die Bandbreite erstreckt sich von einem religiösen Zentrum (der Kaaba in Mekka) über einen Kinderstrich (Steindamm, Hamburg) bis zu einem Hochsicherheitstrakt auf Kuba (Camp V, Guantánamo Bay). Vor allem das Projekt „Cube“ durchlief eine schwierige Zeit. Der schwarze Kubus mit den Maßen der Kaaba in Mekka geriet in den Sog politischer Diskussionen. Auf der Biennale von Venedig wurde es 2005 mit der Begründung abgewiesen, dass die Gefahr terroristischer Anschläge zu groß sei. Schneider wollte die Arbeit im Herzen Venedigs präsentieren, auf dem Markusplatz. Erst 2007 in Hamburg durfte aus einer viel diskutierten Idee ein konkretes Kunstwerk werden. Schneider überlässt nichts dem Zufall. Akribisch begleitet er jeden technischen Einzelschritt, damit das Werk so wird, wie er es sich seit Jahren wünscht. Der Film „Gregor Schneiders Cube Hamburg“ (3sat, 2007, gezeigt auf zahlreichen internationalen Filmfestivals) von Peter Schiering, geboren 1967, dokumentiert den Installationsprozess. Zudem porträtiert der Film den Künstler und erzählt von den unterschiedlichen Ablehnungen, die das Projekt erfahren hat. Der Film spürt der Ambivalenz von Kunstfreiheit, Terrorfurcht und dem Interesse der islamischen Gemeinde in Hamburg an Schneiders Kunstprojekt nach.
Roman Signer
In seinem Video mit dem ironischen Titel „Old Shatterhand“
(2007) betritt Roman Signer einen leeren Raum, stellt sich auf ein
Brett, legt sich einen Massagegurt um die Hüften, angetrieben
von einer Art Schüttelmaschine, die seinen ganzen Körper in Bewegung versetzt, und zielt mit einem altmodischen Revolver auf
eine Blechbüchse. Roman Signer, geboren 1938, zählt seit vielen
Jahren zu den markantesten Künstlern der Gegenwartskunst,
der insbesondere mit seinen von situativem Humor grundierten
Aktionen, Filmen und Zeichnungen, die dem Zusammenhang von
Ursache und Wirkung nachspüren, eine singuläre Position ausprägte. Seine Arbeiten gleichen Versuchsanordnungen, in welchen Transformationsprozesse vorgeführt werden, die nicht selten
im Scheitern des Experiments bzw. in der Zerstörung der Anordnung münden. Doch liegt gerade im Augenscheinlichwerden des Misslingens der eigentliche Erkenntnisgewinn. Signers Untersuchungen der Welt wirkten sich auf nachfolgende Künstler äußerst produktiv aus und führten einem großen Publikum immer wieder die Intensität zweckfreier und hintersinnreicher Konstruktionen vor Augen. Neben den vier Elementen Wasser, Feuer, Luft und Erde setzt Singer insbesondere herkömmliche Alltagsgegenstände wie Eimer, Holzkisten, Kajaks oder Luftballons ein– und auch der Körper des Künstlers wird in Aktionen selbst zum in Mitleidenschaft gezogenen Material.
MÃ¥ns Wrange
Erfolg und Scheitern liegen selten so nah beieinander wie im Sport. Auf der Kurzstrecke entscheiden Sekundenbruchteile über Sieg und Niederlage. Der schwedische Künstler MÃ¥ns Wrange, geboren 1961, hat für die Arbeit „Second Best (From The Encyclopedia of Failure)“ von 1991 16 fotografisch dokumentierte Zieleinläufe aus den Jahren 1906 bis 1966 unter die Lupe genommen. Gewöhnlich richtet sich die ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Brust des Ersten, die das Zielband durchtrennt. Wrange jedoch legt einen roten Ring um die Zweitplatzierten. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hat der Zweite es wirklich verdient, dermaßen aus dem Blickfeld zu geraten? Was muss das für ein Gefühl sein, zu realisieren, dass es aus ist? Steht den Läufern womöglich die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben? Mitunter hätte eine Zehntelsekunde gereicht, um mit dem Sieger gleichzuziehen. Eine Zehntelsekunde, die den Zweiten von der Gewissheit trennt, hier und heute der Beste zu sein. „Wenn man in einer ernsthaften Weise von der Fotografie sprechen will“, schrieb Roland Barthes, „muss man sie in Beziehung zum Tod setzen. Sie ist Zeuge dessen, was nicht mehr ist.“ Das Klicken des Kameraverschlusses ist ein Gewaltakt. Einem Besiegten liefert es den Beweis, dass zumindest dieser eine Sieg für immer verloren ist. Wrange, der ein Faible für Statistiken besitzt, hat die Differenzen zwischen Erst- und Zweitplatziertem bei allen 16 Läufen addiert und folgert, dass die Läufer insgesamt 13 Sekunden von der Unsterblichkeit entfernt seien. In „Second Best“ allerdings erscheinen die Zweitplatzierten als tragische Helden, neben denen die Sieger verblassen. Der sportliche Wettkampf darf pars pro toto für die Leistungsgesellschaft betrachtet werden. Unser sozialer Binärcode ist erschreckend simpel: Gewinner oder Verlierer. Jede gesellschaftliche Leistung ist in irgendeiner Form statistisch erfasst und lässt sich entsprechend codieren. Mit Effizienz hat dies viel, mit Humanität wenig zu tun. Wrange selbst ist ein multimedial agierender Künstler, der sich demonstrativ Zeit nimmt. An „The Encyclopedia of Failure“ („Die Enzyklopädie des Scheiterns“) hat er zehn Jahre gearbeitet. In Kapiteln wie „the forgotten“ („Das Vergessene“), „the unfinished“ („Das Unvollendete“) und „almost succeeding“ („Das beinah Geglückte“) erfasst er Leistungen, die je nach Blickwinkel Hochachtung verdienten, aber systemisch als gescheitert stigmatisiert sind.
Unterstützt durch